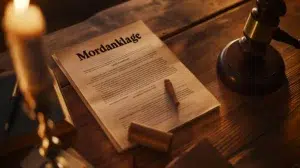- § 370 AO regelt Steuerhinterziehung, ab Vorsatz strafbar
- Strafen reichen von Geldstrafe bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe
- Ab 100.000 € oft Freiheitsstrafe auf Bewährung – ab 1 Mio. € meist ohne Bewährung
- Selbstanzeige kann Straffreiheit bringen, aber nur bei rechtzeitiger und vollständiger Offenlegung
- Fahrlässige Steuerverkürzung (§ 378 AO) ist keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit
Steuerhinterziehung – Die rechtliche Definition
Die gesetzliche Grundlage für Steuerhinterziehung findet sich in § 370 der Abgabenordnung (AO). Dort heißt es sinngemäß:
„Wer den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder sie pflichtwidrig über solche Tatsachen in Unkenntnis lässt, um Steuern zu verkürzen, begeht Steuerhinterziehung.“
Wichtig ist dabei der Vorsatz: Wer absichtlich oder zumindest billigend in Kauf nimmt, dass er dem Staat zu wenig Steuern zahlt, macht sich strafbar. Schon der Versuch der Hinterziehung ist strafbar.
Beispiele für Steuerhinterziehung
- Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit werden in der Steuererklärung nicht angegeben
- Schwarzarbeit wird nicht versteuert
- Vermögen wird ins Ausland verschoben und nicht deklariert
- Rechnungen werden manipuliert oder doppelt verbucht
- Der Handel mit Kryptowährungen (Gewinnrealisierung unter einjähriger Haltefrist) wird verschwiegen
- Scheinrechnungen werden zur Steuerverkürzung genutzt
Fahrlässigkeit oder Vorsatz? Der Unterschied entscheidet über die Strafe
Nicht jede falsche Angabe führt automatisch zu einer strafrechtlichen Verurteilung. Wer versehentlich falsche Beträge einträgt, ohne Täuschungsabsicht, begeht womöglich nur eine Ordnungswidrigkeit nach § 378 AO (fahrlässige Steuerverkürzung). Diese kann mit einem Bußgeld geahndet werden in der Regel jedoch ohne Eintrag ins Führungszeugnis oder strafrechtliche Konsequenzen.
Sobald jedoch ein Vorsatz vorliegt, also der Steuerpflichtige bewusst und gewollt falsche Angaben macht oder relevante Informationen verschweigt, liegt Steuerhinterziehung vor. Und diese ist eine Straftat mit deutlich empfindlicheren Folgen.
Welche Strafen drohen bei Steuerhinterziehung?
Die Bandbreite der Strafen hängt stark vom Ausmaß der hinterzogenen Steuern sowie von den Umständen des Einzelfalls ab. Laut § 370 Abs. 1 AO gilt:
„Steuerhinterziehung wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
In besonders schweren Fällen (z. B. bandenmäßige Begehung, hohe Summen, Missbrauch von Amtsträgerstellung) drohen bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe.
Die Rechtsprechung hat folgende grobe Orientierungsrahmen entwickelt:
- Bis 50.000 € hinterzogene Steuern: meist Geldstrafe
- 50.000–100.000 €: oft Geldstrafe oder Freiheitsstrafe auf Bewährung
- Ab 100.000 €: in der Regel Freiheitsstrafe auf Bewährung
- Ab 1.000.000 €: regelmäßig Freiheitsstrafe ohne Bewährung (vgl. BGH-Urteil 2012, Az.: 1 StR 525/11)
Wichtig: Zu beachten ist, dass auch weitere Aspekte in die Strafzumessung einfließen, etwa die Tatdauer, das Ausmaß des Vorsatzes, eine mögliche Schadenswiedergutmachung, ein Geständnis oder eine bisher weiße Weste.

Ob unerwartete Steuernachforderung, Betriebsprüfung oder Konflikte mit dem Finanzamt – bei steuerrechtlichen Herausforderungen brauchen Sie eine kompetente und erfahrene Partnerin an Ihrer Seite. Jeanette Groß steht Ihnen mit fundierter Fachkenntnis und persönlichem Einsatz zur Seite.
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Situation analysieren und die passende Lösung für Ihren Fall finden.
Verfahrensablauf: Wie läuft ein Steuerstrafverfahren ab?
Ein Steuerstrafverfahren beginnt häufig mit einer Steuerprüfung oder einer anonymen Anzeige, etwa durch ehemalige Geschäftspartner, Mitarbeiter oder Dritte. Verdächtige Auffälligkeiten bei der Steuererklärung können ebenfalls zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens führen.
Ablauf in der Regel:
- Erkenntnisquelle: Betriebsprüfung, Strafanzeige, Auslandsdaten etc.
- Einleitung des Strafverfahrens durch die Bußgeld- und Strafsachenstelle (BuStra)
- Durchsuchung, Beschlagnahme, Anhörung
- Ermittlungsverfahren durch Steuerfahndung oder Staatsanwaltschaft
- Anklage oder Strafbefehl
- Gerichtsverfahren oder Strafmaßverhandlung (ggf. mit Deal)
Je nach Sachlage kann das Verfahren mit einer Einstellung gegen Auflage, einer Geldstrafe oder einer Verurteilung enden.
Selbstanzeige: Ein Ausweg vor der Strafe?
Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist in § 371 AO geregelt und somit ein wichtiger Rettungsanker für alle, die ihre Steuervergehen aus eigenem Antrieb offenlegen wollen, bevor die Behörden ermitteln.
Voraussetzungen für eine wirksame Selbstanzeige:
- Vollständigkeit: Alle unverjährten Steuerstraftaten müssen offengelegt werden
- Korrektheit: Alle Angaben müssen richtig und nachvollziehbar sein
- Rechtzeitigkeit: Die Behörden dürfen noch nicht mit Ermittlungen begonnen haben
- Zahlung: Die hinterzogenen Steuern plus Zinsen müssen frühzeitig nachgezahlt werden
Wird auch nur eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, entfällt die Strafbefreiung und es handelt sich lediglich um ein „Geständnis mit Strafmilderung“.
Seit mehreren Gesetzesverschärfungen (u. a. 2011 und 2015) ist die strafbefreiende Selbstanzeige komplizierter und weniger großzügig geworden, aber weiterhin möglich und in vielen Fällen empfehlenswert.
Beispiele aus der Praxis: Wenn der Fiskus zuschlägt
Fall 1: Der Arzt mit dem Auslandskonto
Ein niedergelassener Arzt verschweigt jahrelang Zinserträge aus einer Schweizer Geldanlage. Die Summe der hinterzogenen Steuern beträgt 180.000 €. Nach Entdeckung durch ein Datenleck wird ein Verfahren eingeleitet, das Gericht verhängt 1 Jahr und 10 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und 200.000 € Geldauflage.
Fall 2: Die Bäckereikette und die Kasse
Ein Unternehmer betreibt mehrere Bäckereifilialen und lässt regelmäßig Umsätze an der Kasse „verschwinden“. Insgesamt werden 1,2 Mio. € an Steuern hinterzogen. Das Gericht erkennt auf besonders schweren Fall – 3 Jahre und 6 Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

Expertenwissen ist Gold wert
Wer mit dem Verdacht auf Steuerhinterziehung konfrontiert ist, sei es durch eine Prüfungsankündigung, sollte möglichst frühzeitig professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. Denn in keinem anderen Bereich des Wirtschaftsstrafrechts ist die juristische und steuerliche Beratung so eng miteinander verzahnt wie bei Steuerdelikten.
Ein erfahrener Steuerberater kann dabei helfen, die tatsächliche steuerliche Lage korrekt zu bewerten, bisherige Fehler aufzuarbeiten und die notwendigen Nachberechnungen oder Korrekturen durchzuführen. Insbesondere bei der Erstellung einer Selbstanzeige ist größte Sorgfalt gefragt. Unvollständige oder fehlerhafte Angaben können dazu führen, dass die Straffreiheit verloren geht. Hier ist es essenziell, dass alle relevanten Steuerzeiträume, Steuerarten und Beträge exakt offengelegt werden.
Gleichzeitig sollte bei konkretem Tatverdacht immer auch ein Fachanwalt für Steuerstrafrecht eingebunden werden. Er kennt nicht nur die Abläufe von Ermittlungs- und Strafverfahren, sondern kann auch die Kommunikation mit der Steuerfahndung, der Bußgeld- und Strafsachenstelle oder der Staatsanwaltschaft übernehmen. Darüber hinaus berät er zur Verfahrensstrategie, prüft die Erfolgsaussichten einer Selbstanzeige und setzt sich, wenn nötig, im Strafprozess für eine Strafmilderung oder Verfahrenseinstellung ein.
Fazit: Steuerhinterziehung kann teuer und strafbar sein – aber es gibt Wege zurück
Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt und kann sowohl finanziell als auch strafrechtlich gravierende Folgen haben. Vor allem bei hohen Summen oder systematischer Vorgehensweise drohen Freiheitsstrafen, teilweise ohne Bewährung. Wer sich frühzeitig beraten lässt, ehrlich ist und gegebenenfalls eine vollständige Selbstanzeige stellt, kann jedoch unter Umständen Schlimmeres verhindern.
Wer das Risiko unterschätzt oder glaubt, der Fiskus würde nicht merken, was fehlt, spielt mit dem Feuer – denn mit internationalen Datenabkommen, digitalen Prüfungen und modernen Ermittlungsmethoden ist der Staat längst auf Augenhöhe.